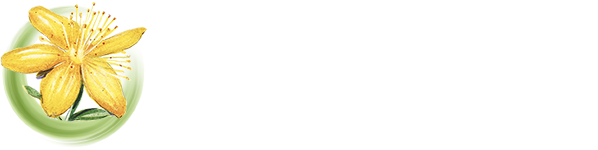Taraxacum officinale
Korbblütler
Erscheinung des Löwenzahn
Jedes Kind kennt sein Aussehen, aber die wenigsten von uns wissen Näheres zum Löwenzahn. Ursprünglich stammt er aus dem Norden Asiens und Europas. Heute ist er auf der gesamten Nordhalbkugel verbreitetet.
In seinem Standort ist der gewöhnliche Löwenzahn anspruchslos und äußerst robust. Man findet ihn eigentlich überall: auf Wiesen und Weiden, an Wegesrändern, in Äckern und Gärten, oftmals auch in kleinsten Ritzen auf Gehsteigen mitten in der Stadt. Er fühlt sich überall dort wohl, wo er auf nährstoffreichen Boden trifft. Oftmals ist er in großer Anzahl auf gedüngten Wiesen zu sehen, wo im Frühling ganze Teppiche an sonnengelb strahlenden Blüten zu bewundern sind.
ABER: Wenn wir vom Löwenzahn sprechen, also dem Unkraut, das überall anzutreffen ist, sprechen wir stets von der Art des Gewöhnlichen Löwenzahns. Es gibt allerdings um die 400 Unterarten und einige davon sind — man mag es kaum glauben — sogar vom Aussterben bedroht! So ist zum Beispiel der Deutsche Löwenzahn eine seltene Pflanzenart, die auf der Roten Liste steht. Er zählt zu den Sumpf-Löwenzähnen und seine Lebensräume, nährstoffarme Sumpf-Wiesen, sind heute selten geworden.
Die typischen Blüten und auch die Pusteblumen sind kaum verwechselbar. Vor der Blüte ähnelt die Pflanze dem Ferkelkraut oder entfernt auch dem gewöhnlichen Habichtskraut. Aber eigentlich ist seine Erscheinung jedem bekannt und die Verwechslungsgefahr äußerst gering.
Die Pflanze produziert einen weißen, milchige Saft, den sie vorwiegend zur Abwehr von Fraßfeinden bildet. Er enthält jede Menge Bitterstoffe und Terpene und ist entgegen der verbreiteten Annahme ungiftig. Lediglich große Mengen sollten wir nicht zu uns nehmen, da er der enthaltene Bitterstoff “Taraxin” in allzu hoher Dosis zu Übelkeit führen kann. Auf unserer Haut hinterlässt diese Milch munter braune Flecken.
Seine Blätter sind vielfach gezähnt, worauf auch sein Name zurück zu führen ist. Bemerkenswert: Jedes Blatt ist einzigartig in seiner Struktur, kein Blatt gleicht dem anderen.
Apropos Name: Laut dem Botaniker Heinrich Marzell gibt es über 500 Namen für den Löwenzahn, unter Anderem Hundeblume, Milchblume, Butterblume oder aufgrund seiner harntreibenden Wirkung auch Bettnässer, Bettsecher oder Pissblume.

Üppige Löwenzahnwiesen deuten auf Überdüngung hin. Das übermäßige Ausbringen von Stickstoff verdrängt andere Kräuter, sodass sich der Löwenzahn fleißig ausbreiten kann.
Die Aufgaben des Löwenzahn: Entwässern, Entgiften, Reinigen
Der Löwenzahn reinigt nicht nur das Blut und wirkt entwässernd, er hilft uns auch bei Magenbeschwerden und Nierenleiden. Zudem gilt er als eines der besten Lebermittel. Auffällig häufige Müdigkeit kann auf eine Leber- bzw. Nierenschwäche hindeuten. Beide Organe sind für die Ausscheidung von Giftstoffen im Blut zuständig. Arbeiten sie nicht richtig, sammeln sich diese Gifte im Körper und schwächen ihn. Dagegen kann der Löwenzahn helfen, indem er sowohl die Leber als auch die Niere in ihrer Tätigkeit unterstützt. Außerdem fördert das enthaltene Inulin als Präbiotikum den Aufbau und Erhalt der Darmflora.

In der Volksheilkunde heißt es, dass die Farbe Gelb der Leber zugeordnet ist. Die intensive Farbe des Löwenzahn-Blüten deutet also auf seine Hauptwirkung hin.
Zusätzlich gilt er als gute Einschleuserpflanze weiterer Nährstoffe. Oftmals können wir Menschen Nährstoffe trotz ausreichender Zufuhr nicht gut aufnehmen. Fühlt man sich trotz gesunder Ernährung oft schlapp und leidet an einem Nährstoffmangel, kann das an einer schlechten Verwertung der zugeführten Stoffe liegen. Einschleuserpflanzen ermöglichen dem Körper, Nahrungsmittel besser zu aufzuspalten, indem sie die Aufnahme über die Härchen im Dünndarm fördern. Der Löwenzahn ist ein Einschleuser für Kalzium.
Löwenzahn sollte nicht gegessen werden bei einem Verschluss der Gallenwege, eitrigen Entzündungen der Gallenblase und Gallenwege und beim Ileus (Darmverschluss).
Verwendung
Eine Löwenzahnkur wird im Frühjahr und im Frühsommer empfohlen und auch von der modernen Pflanzenheilkunde als besonders wirksam bezeichnet. Entweder macht man eine reine Löwenzahn-Kur oder in Kombination mit anderen Kräutern.
Die einfachste Variante ist, im Frühling täglich fünf Blätter roh zu verzehren. Das regt die körpereigene Entgiftung an. Sobald wir auf Bitteres beißen, bildet sich mehr Speichel und die Verdauungssäfte werden angeregt. Vorsicht bei empfindlichen Magen: Bitterstoffe können Beschwerden verursachen, insbesondere wenn wir sie nicht gewöhnt sind. Denn in unserer heutigen Nahrung wurden sie fast vollständig weg gezüchtet.
Frühjahrs Tee Kur mit Löwenzahn
Eine Tee Kur im Frühling sollte 3–4 Wochen dauern. Über diesen Zeitraum trinkt Ihr drei Mal täglich eine Tasse von folgender Mischung:
- Löwenzahnwurzel mit Kraut
- Brennnesselblätter
- Birkenblätter
zu gleichen Teilen gemischt
2 Teelöffel der Mischung mit 1/4 Liter siedendem Wasser über gießen
10 Minuten ziehen lassen, abseihen.
3 x täglich 1 Tasse während der Kur
Die Kombination wirkt entgiftend, entwässernd, blutreinigend, und unterstützt zugleich den Stoffwechsel. Zur Löwenzahnwirkung kommt die der Brennnessel: Förderung der sezernierenden Zellen (Leber, Bauchspeicheldrüse, Darm) und ihre rhythmusregulierende Wirkung sowie die der Birke zur Infektabwehr.
Löwenzahnkapern
Eingelegte Kapern im Supermarkt kaufen ist öde und vor allem teuer! Gesünder, regionaler und auch witziger sind die Löwenzahnkapern und das Rezept ist auch ganz unkompliziert. Probiert’s einfach mal aus!
- 3 Hand voll Löwenzahnknospen (sie sollten noch komplett geschlossen sein)
- Salz
- Essig (Apfel oder Kräuteressig)
Die Knospen mit Salz bestreuen und über Nacht ziehen lassen. Am nächsten Tag den Essig mit Wasser 1:1 mischen und zusammen mit den Knospen aufkochen. Sofort, möglichst kochend, in sterile (vorher abkochen!) Gläser füllen, fest verschließen und auf den Kopf stellen. Es müssen alle “Kapern” mit dem Essigwasser bedeckt sein. So halten sich die Gläschen locker ein Jahr im Kühlschrank oder im Keller.


Ich füge meist noch etwas zur Würze hinzu, zum Beispiel eine Zehe Knoblauch, einen Zweig Rosmarin, einige Pfefferkörner, ein Zweigchen Thymian oder Estragon. Hier könnt Ihr kreativ werden!
Löwenzahn Apfel-Essig
Auch ein ganz einfaches Rezept, um den Apfelessig zu pimpen: Füllt einige voll ausgebildeten Blüten in ein sauberes Glas und füllt dieses mit Apfelessig auf. Das Ganze lasst Ihr ca. 2 Wochen ruhen, bevor Ihr die Blüten abseiht. Und schon habt Ihr einen nochmals gesünderen und schmackhaften Apfelessig gezaubert!

Magisches zum Löwenzahn
Bereits in alten chinesischen Heilbüchern wurde der Löwenzahn als Po gong ying — chinesisches Heilkraut — beschrieben. Heute wird er gar als Ginseng des Westens gefeiert. In europäischen Kräuterbüchern taucht er ab dem 16. Jahrhundert auf.
Nicht nur bei Kindern ist das Wegblasen der gefiederten Pusteblume-Samen beliebt und daraus entstanden vielfältige Orakel: Die Anzahl der stehen gebliebenen Samen zeigt zum Beispiel an, wie viele Jahre man noch leben wird oder wie viele Jahre man noch zur Hochzeit hat. Bläst man alle Samen auf einmal weg, bekommt man ein neues Kleid oder zu Hause gibt es eine gute Suppe.
Auf seelischer Ebene hilft uns der Löwenzahn als Meister der Wandlung Veränderungen anzunehmen, Prozesse in Bewegung zu bringen und Stillstand zu beenden. Er bringt uns die Kraft, um Themen im Alltag zu entwickeln, Impulse zu geben und um Dinge wieder ins Laufen zu bringen.

Allgemeines:
| Vorkommen | humushaltiger Boden an Wegrändern, Wiesen, Ackerflächen, Sonne bis Halbschatten |
| Blütezeit | April, Mai |
| Erntezeit | ganzjährig |
| verwendete Teile | Kraut, Wurzeln, Blüten |
| Inhaltsstoffe | Bitterstoffe (Taraxin und Taraxicin), Carotinoide, Gerbstoffe, Kalium, Saponine, Vitamin C, Schwefel, Kieselsäure, Inulin (=Präbiotikum, gut für Darmflora) |
| Eigenschaften | stärkt Leber, Galle, Niere, Blase, blutreinigend, harntreibend, stoffwechselanregend, belebt den Organismus |
Und eine weitere Besonderheit:
Der Löwenzahn hat eine einmalige Fähigkeit: Er kann sich tatsächlich selbst klonen. Das heißt, er kann sich ungeschlechtlich fortpflanzen, ohne Befruchtung. Diese Nachkommen sind genetisch identisch und haben nicht wie normalerweise einen doppelten Chromosomensatz, sondern einen dreifachen. Sie vermehren sich also asexuell. Auf diese Art der Fortpflanzung kann der Löwenzahn umschalten, wenn sich die Wuchsbedingungen ändern, es zum Beispiel die Witterung für ihn unangenehm wird oder er zu wenige Nährstoffe erhält.